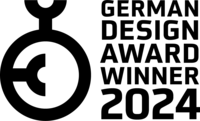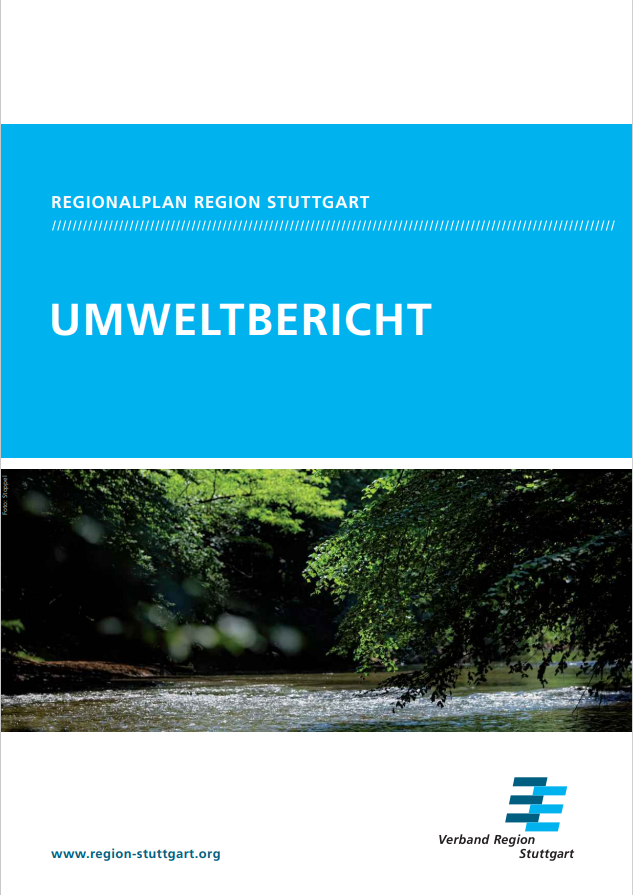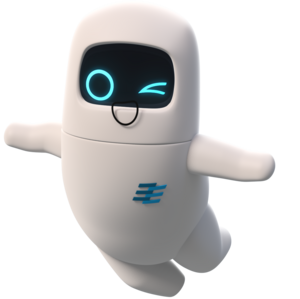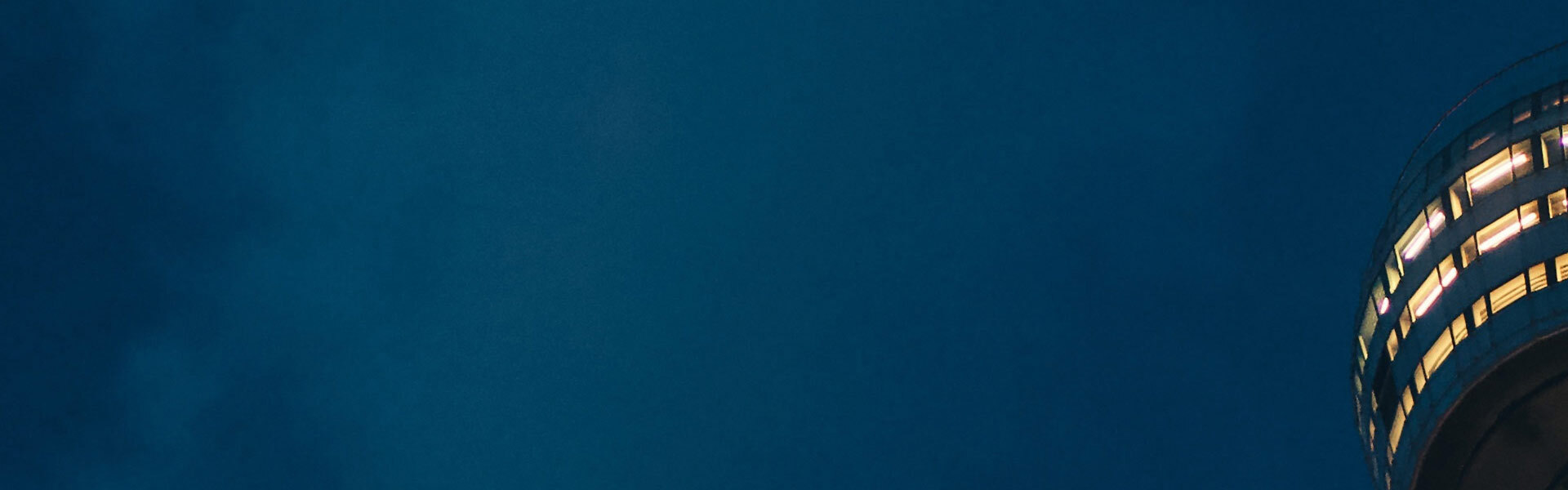Der Regionalplan
Bebauungspläne – ist das nicht Sache der Kommunen? Wer den eigenen Alltag einmal durchdenkt, merkt schnell, dass sich das Leben nicht innerhalb der Gemeindegrenzen abspielt. Egal, ob es zum Arbeitsplatz, zum Sport oder ins Grüne geht, täglich bewegt man sich ganz natürlich zwischen verschiedenen Kommunen. Die Menschen leben regional. Deshalb ist es wichtig, diesen Alltag auch auf regionaler Ebene zu organisieren. Hier kommt der Regionalplan ins Spiel – er bildet eine Gesamtplanung auf regionaler Ebene für etwa 15 Jahre. Auf über 400 Seiten sind die Ziele und Grundsätze zur Raumentwicklung in der Region Stuttgart textlich und zeichnerisch festgelegt.
Die verbindlichen Vorgaben dienen Städten und Gemeinden z. B. dazu, Bebauungspläne zu entwickeln.
Der Regionalplan der Region Stuttgart besteht aus drei – nur in gedruckter Form - rechtsverbindlichen Teilen, die als Satzung von der Regionalversammlung beschlossen werden:
- der Textteil des Regionalplans
- Gesamte Raumnutzungskarte (Legende zur Raumnutzungskarte)
- Raumnutzungskarten für einzelne Abschnitten
- die Strukturkarte der Region mit Raumkategorien, zentralen Orten und Entwicklungsachsen im Maßstab 1:200.000
- die abgeschlossenen Änderungen seit 2009
Raumnutzungskarte

Kartenbereiche 41 - 44
Die zentralen Inhalte des Regionalplans sind:
Siedlungsentwicklung
Der Regionalplan räumt allen Städten und Gemeinden eine ausreichende, bedarfsgerechte Entwicklung ein. Um möglichst schonend mit den noch verbliebenen Freiflächen umzugehen, gilt: Zunächst sollen Baulücken oder Brachflächen bebaut werden, bevor neue Flächen „auf der grünen Wiese“ angetastet werden.
Entwicklungsachsen
An diesen Verbindungen zwischen größeren Zentren, die sich überwiegend an den Bahnlinien orientieren (S-Bahn), sollen neue Wohn- und Gewerbegebiete entstehen. Entwicklungsachsen koordinieren und bündeln die Siedlungsentwicklung. Sie werden durch die Landesplanung festgelegt, im Regionalplan konkretisiert und durch regionale Entwicklungsachsen ergänzt.
Zentrale Orte
In der ganzen Region Stuttgart wird eine gut erreichbare Versorgung der Bevölkerung mit Waren, aber auch privaten und öffentlichen Dienstleistungen angestrebt. Deswegen übernehmen Städte und Gemeinden bestimmte Aufgaben für sich und ihr Umland (Verflechtungsbereich). In Baden-Württemberg werden vier Stufen unterschieden: Oberzentren, Mittelzentren, Unterzentren und Kleinzentren. Die Faustregel lautet: Je höher die Hierarchiestufe, umso spezialisierter die dort zu findenden Einrichtungen und umso größer der Einzugsbereich. Im einzigen Oberzentrum der Region, der Landeshauptstadt Stuttgart, sind also Universitäten, Fachkliniken oder Landesbehörden angesiedelt. In den 14 Mittelzentren gibt es unter anderem weiterführende Schulen, Kinos und Krankenhäuser. Die 12 Unter- und 29 Kleinzentren werden im Regionalplan festgelegt. Dort steht die Versorgung mit häufig nachgefragten Waren und Dienstleistungen wie Schulen oder Arztpraxen im Mittelpunkt. Eine Grundversorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs soll in allen Städten und Gemeinden der Region möglich sein.
Einzelhandel
Läden, hübsch sanierte Ortskerne und Straßencafés kennzeichnen attraktive Innenstädte. Diese lebendigen Stadtzentren zu erhalten und mit ihnen Einkaufsmöglichkeiten, ist schwerer denn je. Der Konzentrationsprozess im Einzelhandel und die Verlagerung von Märkten an den Stadtrand gefährden die wohnortnahe Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs. Der Regionalplan steuert die Standorte für großflächige Einkaufsmärkte. Unter anderem konkretisiert er die zentralörtlichen Siedlungs- und Versorgungskerne. Meist handelt es sich dabei um die Hauptgeschäftsstraßen in den Zentren, wo das Leben pulsiert. Da große Supermärkte mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ein Einzugsgebiet benötigen, das über die Stadtgrenzen hinausreicht, sorgt die Regionalplanung, gewissermaßen als Schiedsrichter, für die überörtliche Abstimmung.
Infrastruktur
Der Erhalt und Ausbau von Infrastruktur werden im Regionalplan sichergestellt, um die Leistungsfähigkeit der Region Stuttgart auch weiterhin zu gewährleisten. Verkehrswege werden ebenso berücksichtigt wie Energieversorgung oder Abfallwirtschaft.
Grünzüge
Dort, wo es das Landschaftsbild zu erhalten gilt, wo Freiräume als „natürliche Klimaanlagen“ für die Menschen oder zur Naherholung dienen, sieht der Regionalplan Regionale Grünzüge vor. Bauen ist in diesen großräumigen, zusammenhängenden Freiräumen nur in wenigen Ausnahmefällen möglich.
Grünzäsuren
Regionale Grünzäsuren sind dort zu finden, wo das Zusammenwachsen von Ortschaften verhindert werden soll. Sie vermeiden also einen „Siedlungsbrei“ und grenzen Nachbarorte voneinander ab. Auch hier gilt ein grundsätzliches Bauverbot.
Umweltbericht
Der Regionalplan liefert nicht nur die verbindlichen Vorgaben, sondern auch die Begründungen dazu. Im Umweltbericht werden alle Umweltbelange zusammengestellt, es erfolgt eine intensive Auseinandersetzung damit, wo gebaut werden kann, wenn gebaut werden muss. Er enthält Informationen insbesondere für die Schutzgüter: Mensch, Flora/Fauna/Biodiversität, Boden, Wasser, Klima, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter. Darüber hinaus zeigt er die Auswirkungen auf den Umweltzustand, die aufgrund der verbindlichen Festlegungen des Regionalplans zu erwarten sind.
Die Printversion zum Bestellen befindet sich im Dokumentenshop.
Änderungen
Der Regionalplan wurde im Jahr 2009 von der Regionalversammlung beschlossen. Doch natürlich kann es immer wieder zu Änderungen kommen, denen die Regionalversammlung in einem transparenten Verfahren, bei dem die Gemeinden und die Bürgerschaft beteiligt werden, zustimmen muss.
Hier ein Überblick über alle aktuell laufenden Verfahren.